Beitragsfoto: Brunnen
Inhaltsverzeichnis
Souveränität
Heute geht es um die digitale Souveränität, die es noch weniger gibt als die europäische oder eine strategische. Stefan Pfeiffer macht dennoch in seinem Blog eine lesenswerte Bestandsaufnahme, was nicht bedeutet, dass ich hierbei seiner Meinung bin.
Ich musste viel zu oft mit nationalen Lösungen arbeiten, die technologisch weit hinter anderen Lösungen hinterherhinkten, von einer Nutzerfreundlichkeit oder einem Service ganz zu schweigen. Was zudem zu dem Problem führte, dass alle im Privaten und wo sie nur konnten mit US-Produkten arbeiteten und sich im Beruf immer wieder umstellen mussten.
Ich bin davon überzeugt, dass dies die Ursache für die Marktmacht von Microsoft auch in unseren Kommunen und Behörden ist. Die Verantwortlichen wissen, dass die Masse ihre Mitarbeiter nicht die intellektuellen Kapazitäten besitzen, um gleich zwei unterschiedliche Systeme bedienen zu können.
Ich scheitere schon seit ein paar Jahren daran, in meinem Umfeld Threema einzuführen. WhatsApp ist angesagt und wird auch trotz vielfältiger Verbote in Behörden und Schulen von allen genutzt. Und wie gesagt, gleich zwei unterschiedliche Systeme zu nutzen, überfordert die meisten Mitbürger.
Zudem ist es das Schöne und meines Erachtens auch Gute am Internet, dass dieses miteinander verknüpft ist. Man kann zwar Insellösungen fahren, dies ist aber absolut nicht im Sinne der Menschheit, die schon immer auf weltweiter Kooperation basiert. Und wer glaubt, dass sein Server im eigenen Keller, der am Netz hängt, vor Zugriff sicher sei, der kennt die Fantasie und Schöpfungskraft seiner Mitbürger nicht. Im Falle, dass man so gut ist, um andere vor einem ungebetenen Zugriff auf die eigenen Daten ausschließen zu können, kann man seine Daten überall parken — was durchaus auch sinnvoll sein kann.
Gesetze zum Datenschutz sind deshalb auch nur so gut, wie sie technologisch nicht juristisch untermauert werden können.
Wo ich mit Stefan Pfeiffer übereinstimme ist, dass man Schnittstellen standardisieren und bei sehr vielen Produkten die Nutzerfreundlichkeit steigern muss sowie Open-Source-Lösungen fördern kann. Auch sollten Transparenz und Talent-Bindung schon längst gängige Praxis sein.
Mein Verständnis von Souveränität ist es aber, dass jeder Mensch und auch juristische Personen selbstständig entscheiden können müssen, was für und wessen Produkte sie selbst nutzen.
Diesen Personen könnte man durch Transparenz und Information bei ihren Entscheidungen behilflich sein, darf dann aber nicht daran verzweifeln, wenn sie weiterhin bei WhatsApp bleiben.
Mein Verständnis von Souveränität ist es auch, ob europäisch, strategisch oder digital, dass man weiterhin weltoffen bleibt und sich tunlichst davor hütet, eine digitale DDR zu schaffen — tut einfach keinem gut!
Nachtrag 28.8.2025
Stefan Pfeiffer hat auf meinen Kommentar geantwortet. Eigentlich wollte ich gleich vor Ort retournieren, leider mag das WordPress.com nicht und sperrt mich dabei aus — ich muss einmal Detlef Stern um Hilfe bitten, denn ich kann es nicht nachvollziehen.
Also nun hier meine Antwort auf Stefan Pfeiffers Antwort: Europäisch schön und gut, aber hier ist wohl die EU gemeint. Wir Unionsbürger stellen gerade einmal gut 5 % der Weltbevölkerung. Und damit wäre dies immer noch eine sehr kleine Insellösung (Stichwort: Superstaateuropäer — wobei ich betone, dass ich Stefan Pfeiffer für keinen solchen halte.)
Hertenstein
Auf mein letztes Rundschreiben an 245 Abonnenten bekam ich eine einzige Antwort, ein mageres Ergebnis. Die Öffnungsrate von ca. 50 % ist zufriedenstellend. Was in sich aber wieder stimmig ist, da man schon länger davon ausgehen kann, dass man je 100 Leser eine Antwort erhält.
Und so freue ich mich jedes Mal, wenn ich eine Reaktion auf einen Blog-Beitrag erhalte, weil ich dann davon ausgehen kann, dass dieser von weiteren 99 Menschen gelesen wurde. Selbstverständlich gilt dies alles nur für den Hobby-Bereich. Im echten Leben weiß ich, dass 99 % der Adressaten eine an sie versandte Nachricht nicht nur lesen, sondern auch weiter verarbeiten. Und das ist das Schöne, wenn man mit Profis arbeiten darf und kann!
So ist es nun auch nicht verwunderlich, dass wir bis zum Schluss nicht wissen können, wer nun so alles zu den 9. Hertensteiner Gesprächen kommen wird; Stand heute sind es 95 Teilnehmer. Die bisher gemachte Erfahrung zeigt, dass man gut 120 Anmeldungen benötigt, um 100 Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Trotz dieser Erfahrung bin ich dennoch immer wieder geneigt, doch so viele Teilnehmer wie gemeldet in die Rechnung mit aufzunehmen — da kommt dann doch einfach der Optimist durch.
Schön wäre es, wenn es auch im Ehrenamt und Freiwilligendienst mehr Verbindlichkeit gäbe, leider aber greift inzwischen die Unverbindlichkeit sogar bei den Profis voll durch. Und damit sind solche Veranstaltungen zu einem regelrechten Vabanquespiel geworden. Vielleicht auch der Grund, warum sich immer mehr Ehrenamtlicher nicht mehr darauf einlassen.
Anfang September müssen wir, was die 9. Hertensteiner Gespräche angeht, mit dem Parkhotel und der Gastronomie Nägel mit Köpfen machen, für einen Verein und dies auch wenn wir inzwischen von anderen Vereinen unterstützt werden, doch jedes Mal eine kleine Herausforderung. Danach geht es „nur“ noch um die Inhalte, an denen bis zum Schluss weiter gefeilt wird.
Ärgerlich wird es dann, wenn man zu oder gleich nach den Gesprächen wieder einmal erfahren muss, dass sich jemand ganz dringend und maßgeblich auch noch engagieren wollte und wir schuld seien, weil wird diesen VIP nicht rechtzeitig informiert zu haben.
Und so erlaube ich mir gleich an dieser Stelle auf die 10. Hertensteiner Gespräche hinzuweisen, die am Samstag, 19. September 2026 stattfinden werden.
Vermischtes
Felix Schwenzel schwärmt in einem Blog-Beitrag über „Früher™ [im Internet]“. Ich durfte das Internet bereits in den 1980er-Jahren kennenlernen und fragte mich dabei fast 20 Jahre lang, ob es überhaupt privat sinnvoll zu nutzen wäre. Sehr viele andere erkannten schon damals das große Potenzial, das im Internet steckt. Ganz wenige die übergroße Gefahr, die damit verbunden ist.
Heute bin ich der Auffassung u. a. von Detlef Stern [zumindest glaube ich ihn so zu verstehen], dass man nur das nutzen sollte, was man auch selber bauen kann. Allerdings mit der Einschränkung [weil selber viel zu faul], dass es auch reicht, wenn man es tatsächlich selber bauen könnte.
Wobei viel zu viele Menschen an Dingen kein Interesse mehr haben, wenn sie diese noch selber machen könnten oder gar verstehen würden — nehmen wir nur mal das Essen im allgemeinen oder den Eistee im besonderen, den man jetzt bereits in Pappgefäßen kaufen kann. Noch populärer Zuckerwasser in Dosen jeder Art.
Gartenarbeit ist jüngst angesagt, gestern und vorgestern kam noch Franz Schirm zur Unterstützung. Auch was die Gartenarbeit anbelangt, komme ich aus einer ganz anderen Ecke, meine Kampfstände in Rosenbeeten waren in den 1980er-Jahren legendär und schafften es sogar einmal in die Zeitung. Inzwischen schlage ich längst keine Schneisen mehr, sondern schnipsele so vor mich hin. Wobei ich feststellen muss, dass ich für die vorhandenen Werkzeuge eindeutig zu grobschlächtig bin.
Sollte sich die Gartenarbeit bei mir als Lebensabendbeschäftigung etablieren, dann müssen langsam aber sicher richtige Werkzeuge ran; Rita und Jörg Mühlemeier haben mir ihren entsprechenden Fuhr- und Werkzeugpark bereits vorgestellt.
Und wer weiß, vielleicht komme ich auch wieder auf den eigenen Hund. Apropos Hunde, aktuell sind bei uns wieder jene Viecher angesagt, die zusammen mit ihren weit überdimensionierten Leinenkonstruktionen (Zaumzeug) kaum das Gewicht einer Hauskatze auf die Beine stellen. In meiner Jugend konkurrierten Hunde noch gewichtsmäßig mit den jungen Damen, welche man gerne auf die Spaziergänge mitnahm.
Was aber durchaus fragen lässt, warum man einen Hund anleinen und versteuern muss, die größeren Hauskatzen aber weiter völlig ungestraft ihr Unwesen treiben dürfen. Schlimmer noch, ein Katzenbesitzer muss seinem Haustier nicht hinterher räumen, die dürfen selbst ungestraft in Nachbarsgarten scheißen.
Als ich gerade das Schlagwort „Gartenarbeit“ neu erstellte, fiel mir auf, dass es sich bei diesem Wort um ein waschechtes Oxymoron handelt. Gärtner von Beruf arbeiten auch in Gärten, wobei diese wohl nicht von Gartenarbeit sprechen, und alle anderen Menschen gärtnern in einem Garten, auf Deutsch, sie vergnügen sich dort, was somit keine Arbeit ist. Und wäre es tatsächlich Arbeit, dann würden dies bei uns schon längst andere machen.
Gestern saß ich eine ganze Weile an einem Brunnen und genoss die Totenstille in einem Heilbronner Stadtteil. Wären nicht ab und zu ein paar meist leere Stadtbusse vorbeigekommen, hätte ich fast an ein militärisches Übungsdorf zur Mittagszeit gedacht. Ok, dort funktionieren die Brunnen nicht mehr.
Wer sich nun dafür interessiert, in welchem Stadtteil ich unterwegs war, dem hilft der Brunnen weiter. Technologisch versierte Leser analysieren einfach die Meta-Daten des Bildes — das wäre dann aber Trickserei.

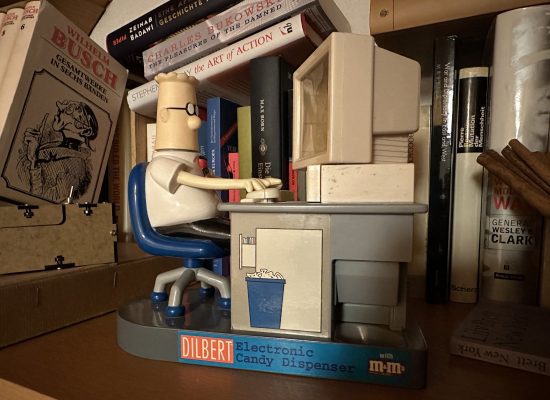






2 thoughts on “27.8.02025”
Das ist der Saureiter-Brunnen in Sontheim, im Rücken Model-Bestattungen und eine Kleintierklinik, links Gerda’s Laden.
Wobei sich die Mini-Kette nicht nur falsch schreibt, sondern auch noch Dienstagnachmittag geschlossen hat. Ansonsten wäre wohl um den Brunnen herum etwas mehr los gewesen.